

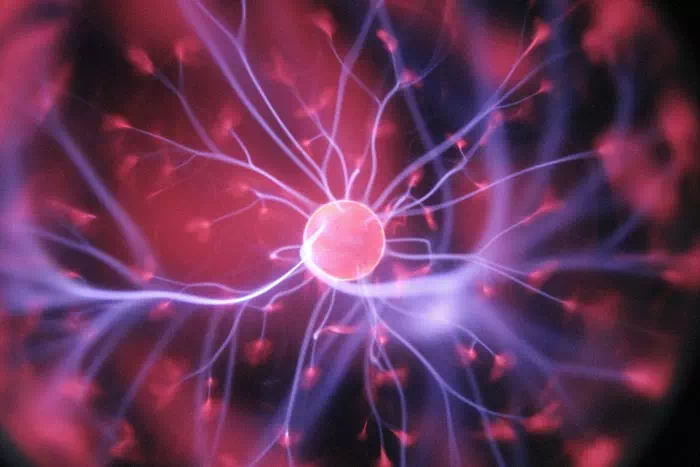 © Hal Gatewood/Unsplash
© Hal Gatewood/Unsplash
Die Schulkinder von heute erfahren, dass wir in einem Universum leben, das ungefähr 14 Milliarden Jahre alt ist und sich kontinuierlich ausdehnt. Diese Vorstellung ist derart verbreitet, dass es uns schwerfällt zu verstehen, dass sie vor knapp einhundert Jahren zu einem Umbruch in der Physik und der Astronomie führte.
Vor 150 Jahren wurde der Begriff der Evolution durch das Buch Entstehung der Arten von Charles Darwin allgemein bekannt. Damit einher ging eine Erklärung für den Ursprung und die Vielfalt des Lebens auf der Erde, die ohne einen Gott auskam. Spätere Forschungen in den Bereichen Mikrobiologie, Genetik und Biochemie haben die Evolutionstheorie zwar bereichert, aber nicht ohne neue Fragen aufzuwerfen. Die Kompliziertheit und Vielfalt, die von diesen neueren Forschungen zutage gefördert wurden, stellen die grundlegende Richtigkeit der Evolutionstheorie ernsthaft in Frage.
Die neuere Evolutionstheorie setzt eine gewaltige Menge an Zeit voraus, aber die heutigen Schätzungen für das Alter des Universums lassen eine solche Zeitmenge gar nicht zu. Bisher konnte niemand diese Widersprüche auflösen.
Wenn man die gesamten Erkenntnisse der Naturwissenschaften betrachtet, die in den letzten 150 Jahren gewonnen wurden, kommt man am Glauben an einen Schöpfergott nicht vorbei. Darüber hinaus kann man sagen, dass die biblischen Aussagen zum Schöpfergott von den neuesten Erkenntnissen der Naturwissenschaften untermauert werden.
Diese Tatsache hat aber nicht dazu geführt, dass weltliche Denker die Existenz Gottes nicht mehr in Frage stellen. Vielmehr werden immer neue Einwände gegen den Glauben an einen Gott erhoben. Sie beruhen aber insgesamt auf merkwürdigen Erklärungen, die nichts mit den Naturwissenschaften zu tun haben und von vornherein die Möglichkeit eines göttlichen Wesens ausschließen.
Im andauernden Kampf um solide Naturwissenschaften wollen sich die größten Denker erst gar nicht mit der Existenz eines Gottes befassen. Woran liegt das?
Beobachtungen sind ein grundlegender Teil aller Naturwissenschaften. Wenn man ein Phänomen beobachtet hat, kann man Hypothesen aufstellen und diese prüfen, Daten sammeln, Modelle erfinden und Theorien entwickeln. Die Praxis der Naturwissenschaften ist äußerst mühsam und langwierig, aber auch mit aufregenden Einsichten und Erkenntnissen verbunden.
Zu einer naturwissenschaftlichen Beobachtung gehört eine konzentrierte Achtung auf Einzelheiten mit dem Ziel, Muster zu erkennen und Regeln zu ermitteln, nach denen ein System funktioniert. Die Musterkennung liegt in der Natur des Menschen. Das ist das Mittel, mit dem unser Gehirn die Signale der Augen und der anderen Sinne tagaus, tagein ordnet und deutet. Auch unsere Sprachfähigkeit beruht auf Mustererkennung. Verbunden mit der Fähigkeit, abstrakt zu denken und zu überlegen, versetzt uns die Mustererkennung in die Lage, die natürliche Welt zu untersuchen und zu verstehen.
Unsere natürlichen Beobachtungsfähigkeiten sind jedoch deutlich beschränkt. Daher ist die Entwicklung von Werkzeugen, die unsere Wahrnehmungsfähigkeiten ergänzen und erweitern, in den Naturwissenschaften eine treibende Kraft. Beispielsweise hat das Fernrohr Aspekte des Universums sichtbar gemacht, die uns vorher verborgen waren. Damit taten sich für uns neue Welten auf. Das Mikroskop hat Ähnliches am anderen Ende des Größenspektrums bewirkt. Damit können wir Gebilde in lebenden Zellen ausmachen und sogar bis zur atomaren Ebene durchdringen.
Und es hört mit Ergänzungen unseres Sehvermögens nicht auf. Wir haben auch Werkzeuge entwickelt, die elektromagnetische Strahlen, magnetische Felder, feine Bewegungen der Erde, Wärmeunterschriften, chemische Verbindungen und noch vieles Weitere mehr wahrnehmen können!
Fortschritte in den Naturwissenschaften beruhen also nicht nur auf Versuchen und Gedankenexperimenten, sondern auch auf der Entwicklung neuer Beobachtungsmittel, die uns bisher verborgene Phänomene erschließen, die wir dann studieren können. Diese Fortschritte gehen also Hand in Hand mit Fortschritten in der Technik.
Man kann schon Verständnis für Naturforscher aufbringen, wenn, wie es oft in der Geschichte der Fall war, ihnen etwas entgeht, was kaum wahrzunehmen ist. Ein markantes Beispiel war die Entdeckung, dass sich das Universum ausdehnt – eine Erkenntnis, die nur durch die Entwicklung neuer Messinstrumente möglich wurde.
Es ist noch nicht so lange her, dass alle verfügbaren Daten die Vorstellung von einem Universum im Gleichgewicht unterstützten. Diese Vorstellung wurde auch nicht ernsthaft in Frage gestellt. Zu dieser Vorstellung gehörte die Ansicht, dass der Raum keine Grenzen hatte und sich nicht verändern konnte, während die Zeit sich ewig nach vorne und hinten erstreckte. Inzwischen gilt diese Anschauung als überholt. Heute wird angenommen, dass der Raum schrumpfen oder sich ausdehnen kann und dass das Weltall einen Anfang hatte.
Das statische Universum hatte einen besonderen Reiz für Denker, die Gott aus ihrem Weltbild ausschließen wollten. Wenn das Universum keinen Anfang hatte, war auch kein Schöpfer nötig!
1915 hat der vielleicht bekannteste Naturwissenschaftler aller Zeiten, Albert Einstein, Gleichungen vorgelegt, die das seit 200 Jahren herrschende Weltbild Isaac Newtons auf den Kopf stellten. Etwas Merkwürdiges aber störte ihn, nämlich das Universum schien nicht mehr statisch zu sein!
Diese Gleichungen schienen zu zeigen, dass der Raum selbst sich ausdehnte. Das widerstrebte der herrschenden Meinung und auch Einstein. 1917 hat Einstein dann eine bewusste Änderung in seine Gleichungen eingefügt, um die Schlussfolgerung der Ausdehnung auszuschalten.
Trotz dieses Notbehelfs stürzten sich Naturforscher auf die Frage: Wenn sich das Universum tatsächlich ausdehnt, wie können wir das feststellen?
Der Astronom Edwin Hubble fand eine Methode: Die Wellenlängen des Lichts, das von fernen Sternen ausgestrahlt wird, zu messen. 1930 hat diese Vorgehensweise zu der Erkenntnis geführt, dass ferne Sterne roter erschienen, als man erwartet hätte. Das war ein Beispiel des Dopplereffekts, den man auch erleben kann, wenn ein Krankenwagen vorbeirast. Zuerst ist die Tonhöhe der Sirene höher, wird aber zunehmend niedriger. Das liegt an einer Verkürzung bzw. Verlängerung der Schallwellen der Sirene.
Wenn der Krankenwagen näher kommt, werden die Wellen verkürzt, und wenn er sich entfernt, werden sie verlängert. Die Rotverschiebung bei Galaxien und Sternen war ein Hinweis darauf, dass sie sich von uns entfernen. Diese Entdeckung Hubbles ist der Schlüsselbeweis für die Ausdehnung des Universums, die aus Einsteins Theorie hervorging.
Nachdem feststand, dass sich das Universum ausdehnt, war es nur naheliegend, davon auszugehen, dass die Ausdehnung irgendwann begonnen hatte. Das führte zum Begriff des Urknalls. Die modernen Naturwissenschaften fanden damit zu einer grundlegenden Wahrheit zurück, die schon im ersten Vers der Bibel verzeichnet ist: „Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde“ (1. Mose 1,1).
Durch weitere Experimente, Messungen der Lichtstrahlung von den entferntesten Sternen und andere Mittel sind Naturwissenschaftler zu dem Schluss gekommen, dass das Universum vor etwa 14 Milliarden Jahren als ein geballtes Energiebündel begann, das sich plötzlich in jede Richtung ausdehnte. Im Laufe dieser Ausdehnung entstanden Sterne und Planeten.
Die Nachglut dieser Ausdehnung, die als kosmischer Mikrowellenhintergrund bekannt ist, wurde zum ersten Mal im Jahr 1964 von empfindlichen Radioteleskopen wahrgenommen. Seither bemühen sich Physiker um die Antwort auf die Frage, wie und warum der Urknall stattfand.
Bevor man über die technischen Möglichkeiten verfügte, mit deren Hilfe man feststellen konnte, dass sich das Universum ausdehnt, kam niemand auf die Idee, Beweise dafür zu finden, dass es statisch war, was wohl daran lag, dass die Vorstellung eines Universums im Gleichgewicht als beruhigend galt.
Rund fünfzig Jahre vor dem Aufkommen von Einsteins Relativitätstheorie trat Darwins Evolutionstheorie auf. Hintergrund dafür waren ebenfalls begrenzte Beobachtungsmittel und vor allem die Abweisung der Heiligen Schrift.
1859 wurde Die Entstehung der Arten von Charles Darwin veröffentlicht. Die zentrale Botschaft dieses Buches war, dass die Arten durch Evolution mittels natürlicher Auslese entstanden sein sollen. Als Darwin durch die Galapagosinseln zog, war seine wichtigste Erkenntnis, dass die Finken auf jeder Insel besondere Eigenschaften aufwiesen, die auf die Nahrungsquellen und weitere Merkmale der jeweiligen Insel abgestimmt waren.
Seine Schlussfolgerung daraus war, dass eine einheitliche Finkenbevölkerung zu der Inselgruppe gekommen war und sich im Laufe der Zeit, je nach Insel, unterschiedlich entwickelt hatte. Damit war der Begriff der natürlichen Auslese geboren. Die Vögel mit den für die jeweilige Umwelt vorteilhaftesten Merkmalen waren gediehen und hatten diese Merkmale weitervererbt.
Jenseits von natürlicher Auslese und Anpassung an die Umwelt aber spekulierte Darwin über die Möglichkeit, dass alle Lebewesen einen gemeinsamen Vorfahren hatten oder sich wenigstens in Gruppen einteilen ließen, die jeweils von einem gemeinsamen Vorfahren abstammten.
1871 sprach er in einem Brief an Joseph Hooker von der Möglichkeit, dass der Ursprung des Lebendigen nichts mit einem Schöpfergott zu tun hätte: „Wenn es aber (und es ist ein großes WENN) denkbar wäre, dass in einem warmen Teich, gefüllt mit Ammoniak und allerlei Phosphorsalzen und angestrahlt von Licht, Wärme und Elektrizität, eine Eiweißverbindung entstand, die in der Lage gewesen wäre, noch komplexere Verbindungen einzugehen . . .“ (zitiert nach Monica Grady, Evidence, herausgegeben von Andrew Bell, John Swenson-Wright und Karin Tybjerg, 2008, Seite 81).
Obwohl Darwin selbst nicht viel von dieser Vorstellung hielt, wurde sie von anderen aufgegriffen. Der Gedanke, dass irgendwann und irgendwo in einem „warmen Teich“ ein zufällig zusammengewürfeltes Chemikaliengemisch spontan in etwas Lebendiges verwandelt wurde, verbreitete sich.
Darwin wusste nichts von der Genetik. Verglichen mit heutigen Verfahren war seine Methode der Datensammlung recht grob. So zeichnete er Bilder von Vögeln mit ähnlichem Aussehen, bis ihm dämmerte, dass sich Arten im Laufe mehrerer Generationen ihrer Umwelt anpassen können.
Die Daten, die Darwin zur Verfügung standen, waren keine ausreichende Grundlage für die Spekulation, dass alle Arten einschließlich des Menschen von einem gemeinsamen Vorfahren abstammten, der einmal in einem warmen Teich entstand. Andere aber, die eine Erklärung für den Ursprung und die Weiterentwicklung des Lebens suchten, die Gott aus dem Spiel ließ, unterstellten diese Vorstellung jedoch als Tatsache.
Die Anpassung durch natürliche Auslese, von der Darwin sprach und die heute „Mikroevolution“ genannt wird, steht nicht im Widerspruch zur Bibel. Nach der Bibel (siehe zum Beispiel 1. Mose 1,11) pflanzt sich jedes Lebewesen „nach seiner Art“ fort. Aber auch heute haben die Naturwissenschaften noch keinerlei Beweise für die Vorstellung vorlegen können, dass neue Arten aus alten entstehen können. Von dem ersten Finkenschwarm, der zu den Galapagosinseln gelangte, entstanden Finken mit unterschiedlichen Merkmalen, aber sie alle waren trotzdem noch Vögel.
Das Prinzip der Makroevolution dagegen besagt, dass eine höhere Art – wie der Frosch, der Vogel, der Tiger oder der Elefant – aus einer niederen Art – wie einem Bakterium – nach einer ausreichenden Anzahl an Generationen entstehen kann. Diese Vorstellung steht nicht nur im Widerspruch zur Bibel, sondern wird auch von keinerlei wissenschaftlichen Beweisen unterstützt. Die Vorstellung der Makroevolution stammt von groben Vergleichen, wie sie Darwin mit den Finken anstellte, und fand ihren Ausdruck in den klassischen Bilderreihen, die links einen Affen zeigen und – mit mehreren Stufen dazwischen – rechts einen Menschen.
160 Jahre nach der Veröffentlichung von Entstehung der Arten versuchen die weltlichen Naturwissenschaften heute mit allen Mitteln, eine Erklärung durchzusetzen, die an den haltlosen Spekulationen Darwins festhält, nach denen das Leben durch Zufall in einem warmen Teich entstand und durch Makroevolution den Menschen hervorbrachte.
Neue Forschungszweige wurden nicht immer objektiv, sondern oft durch diese Linse betrachtet. Man findet zum Beispiel in der Genetik und der Biochemie starke Widersprüche zwischen den Beobachtungen und diesem atheistischen Programm. Wenn man außerdem davon ausgeht, dass das Universum erst 14 Milliarden Jahre alt ist, treten die Widersprüche noch deutlicher zutage.
Wenn uns heute die natürliche Auslese selbstverständlich vorkommt, liegt das daran, dass wir viel mehr über die Natur wissen, als es zu Darwins Zeit der Fall war. So wissen wir heute, dass die verschiedenen Merkmale, die Darwin in seinen Finken beobachtete, von ihren aus DNA bestehenden Genen bestimmt waren. Diese Gene hatten die Vögel von ihren Eltern geerbt.
Die Genetik schien in der Lage zu sein, den riesigen Glaubenssprung Darwins zur Makroevolution hin mit einem Mechanismus zu versehen. Für die Vorstellung, dass alle Lebewesen von gemeinsamen Vorfahren abstammten, hatte Darwin keine Erklärung, aber Genetiker kamen auf die Idee, dass zufällige Mutationen in den Erbanlagen sich manchmal als vorteilhaft erweisen könnten. War das der Fall, konnten die mutierten Gene, durch die natürliche Auslese begünstigt, an nachfolgende Generationen weitergegeben werden.
Ohne Rücksicht auf die Realität wurden zufällige Mutationen in Verbindung mit der natürlichen Auslese als Treibkraft der Evolution angesehen. Damit schien endlich der Weg frei dafür, die Vielfalt und Kompliziertheit des Lebendigen ohne Rückgriff auf einen Schöpfergott zu erklären.
Oberflächlich betrachtet mag die Erklärung eine gewisse Glaubwürdigkeit besitzen. Aber hält sie einer eingehenden Prüfung stand? Das wollen wir uns näher ansehen.
Die Biochemie lehrt uns, dass selbst die einfachsten Lebensformen überhaupt nicht einfach sind. Wenn die Evolution tatsächlich stattgefunden hat, muss sie demnach auf einer Ebene stattgefunden haben, die viel tiefer liegt als die sichtbare Ebene. Das heißt, sie muss auf der Zellen-, wenn nicht schon auf der Molekularebene stattgefunden haben.
Wenn wir die Natur mit dem bloßen Auge betrachten, ist sie schon kompliziert genug, aber wenn wir hierfür ein Mikroskop heranziehen, wird sie um ein Tausendfaches komplizierter. Wie haben die Zellen eines Finken oder eines anderen beliebigen Lebewesens die fein abgestimmten Regelkreise entwickelt, die dafür sorgen, dass nur bestimmte Moleküle die Zellmembran durchdringen? Und wie haben die Organismen die Transportsysteme entwickelt, die Botenmoleküle von den Zellen in einem Organ zu einem bestimmten Ziel in einem anderen Organ bringen?
Diese Fragen sind weitaus grundlegender als die Frage, wie ein bestimmter Schnabel oder der Geschmacks- und Geruchssinn eines Finken entstand. Sie sind aber keineswegs einfacher. Sie sind deswegen schwierig, weil wir es mit komplexen Systemen zu tun haben, die nur als Ganzheiten funktionieren können. Diese Systeme sind wie winzige Maschinen, die bestimmte Aufgaben erfüllen, auf die eine Zelle angewiesen ist.
Dass ein System nur als Ganzheit funktioniert bedeutet, dass es überhaupt nicht funktionieren würde, wenn auch nur eine seiner vielen Komponenten fehlte oder fehlfunktionierte. Es liegt auf der Hand, dass ein solches System auf keinen Fall aus zufälligen Mutationen entstehen könnte, weil es dann durch viele nicht funktionierende Stufen gehen müsste. Vielmehr müsste es in einem Zug als Ganzheit entstanden sein.
Als Analogie könnte man die Herstellung eines Autos nehmen. In den frühen Phasen könnte es überhaupt nicht funktionieren. Auch in der Schlussphase würde es nicht funktionieren, wenn die Räder quadratförmig wären und sich nicht drehten.
Wir sprechen hier, wohlgemerkt, nicht von einem Auto ohne Räder, sondern von einem Auto mit Rädern, die für ihre Aufgabe nicht ganz tauglich sind. Obwohl sie nicht weit von der Funktionsfähigkeit entfernt sind, funktioniert das Auto trotzdem nicht. Mit anderen Worten: Nahe dran ist nicht gut genug.
Wenn es nun um lebende Organismen geht, ist hundertprozentige Funktionsfähigkeit überlebensnotwendig und eine Voraussetzung für die Weitergabe von Erbanlagen an nachfolgende Generationen, wie sie von der Evolutionstheorie gefordert wird.
Biologische Systeme, die nur als Ganzheiten funktionsfähig sind, können nur dann in tauglicher Form entstehen, wenn mehrere Mutationen gleichzeitig vorkommen. Wenn nun schon die Wahrscheinlichkeit einer einzelnen Mutation sehr gering ist, liegt es auf der Hand, dass die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Auftretens mehrerer Mutationen, die gemeinsam zu einem Vorteil führen, so gering ist, dass man es ganz ausschließen kann.
Zufällige Mutationen kommen in der Natur sehr selten vor. Das menschliche Erbgut besteht aus drei Milliarden (3 mal 109) Basenpaaren. Bei einem Fortpflanzungsvorgang wäre nach bisherigen Erfahrungen mit einer Mutation in nur einem Basenpaar zu rechnen. Nehmen wir an, dass eine bestimmte Mutation zu einem Vorteil führen würde. Bei einer Weltbevölkerung von sieben Milliarden Menschen könnten wir erwarten, dass vielleicht zwei Menschen diese Mutation aufweisen.
Was aber, wenn zwei Mutationen erforderlich sind? Dann schrumpft die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs auf eins zu 9 mal 1018. Bei sieben Milliarden Menschen müsste man dann die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Mensch in der ganzen Welt die beiden Mutationen aufweist, auf eins zu 1,3 mal 109 (9 mal 1018 dividiert durch 7 mal 109) schätzen. Man müsste also davon ausgehen, dass etwa 1,3 mal 109 Generationen erforderlich wären, um die erwünschte Doppelmutation herbeizuführen. Bei einem Generationsalter von 25 Jahren würde das eine Zeitdauer von über 32 Milliarden Jahre erfordern. In Wirklichkeit sind häufig Dutzende von Mutationen zu einem Vorteil notwendig, wodurch eine noch längere Dauer erforderlich würde.
Wie wir bereits festgestellt haben, wird das Alter des Universums von den meisten Naturwissenschaftlern auf circa 14 Milliarden und das Alter der Erde auf circa 4,5 Milliarden Jahre geschätzt. Das Leben auf der Erde soll vor etwa 3,5 Milliarden Jahren in einem „kleinen, warmen Teich“ entstanden sein. Für menschliche Verhältnisse mögen 3,5 Milliarden Jahre zwar eine lange Zeit sein, aber für die spontane Entwicklung eines einzigen Systems, das nur als Ganzheit funktioniert, sind sie bei Weitem nicht genug!
Wir haben gesehen, dass es äußerst unwahrscheinlich ist, dass die Makroevolution, das heißt, die Entwicklung komplexer Lebewesen aus einfacheren Formen, überhaupt stattgefunden hat. Das ist aber längst nicht das Ende der Schwierigkeiten mit dieser Theorie. Denn sie erklärt darüber hinaus auch nicht, wie diese einfachen Urformen selbst entstanden sind!
Materialistische Erklärungen für das Leben und das Universum stehen und fallen mit der Frage der Ursprünge. Wie sind Lebewesen aus ungeordneten, leblosen Stoffen entstanden?
Wenige Jahrzehnte vor der Zeit Darwins führte der Mikrobiologe Louis Pasteur eine Reihe von Versuchen durch, die der lange gehegten Vorstellung, dass Lebewesen aus dem Nichts entstehen können, die Grundlage entzogen. Die Ansicht, dass Lebewesen aus dem Nichts entstehen können, war noch radikaler als die heutige Annahme, dass die ersten Lebensformen aus toter Materie spontan gebildet wurden. Diese mildere Hypothese firmiert in der Fachwelt unter dem Namen Abiogenese.
Vor Pasteurs Versuchen meinten viele, dass Hefe einfach so entstehen könne, weil sie oft dort auftrat, wo vorher nichts erkennbar war. Ohne ausreichend starke Mikroskope war das auch verständlich.
Pasteur zeigte, dass Hefe nicht in einem sterilen, verschlossenen Gefäß entstand, und zog daraus den Schluss, dass sie nur dann entstehen konnte, wenn bereits etwas Lebendes vorhanden war. Er stellte das Prinzip der Biogenese auf, wonach Leben nur von Leben kommen kann. Diese revolutionäre Entdeckung war der Hintergrund für Darwins Überlegungen und liefert vielleicht eine Erklärung dafür, dass der Urheber der Evolutionstheorie nicht bereit war, öffentlich zu behaupten, dass irdisches Leben aus toter Materie entstanden sei.
Trotz mehrerer Versuche ist bisher niemandem der Nachweis gelungen, dass Leben aus toter Materie entstehen kann.
Als Beweis dafür, dass Leben aus toter Materie entstehen kann, wird hin und wieder das Miller-Urey-Experiment aus dem Jahre 1952 angeführt. Das ist aber eine Fehldeutung des Ergebnisses dieses Versuchs. Miller und Urey bearbeiteten ein Gemisch aus Wasser, Methan, Ammoniak und Wasserstoff mit Stromstößen, die Blitze simulieren sollten.
Es entstanden zwar Aminosäuren, die wichtige Bausteine aller Lebewesen sind, aber Aminosäuren für sich erfüllen noch längst nicht die Kriterien für Lebensformen, wie zum Beispiel die Fähigkeit der Fortpflanzung. Diesem Versuch, der mit der Entstehung einiger Aminosäuren endete, gingen viele Fehlschläge, bei denen andere Rezepte für die Ursuppe ausprobiert wurden, voraus. Mit anderen Worten: Selbst die Entstehung der Aminosäuren verlangt fein abgestimmte Anfangsbedingungen.
Wenn es bislang noch niemandem gelungen ist, ein konkretes Beispiel für die Abiogenese, das heißt die Entstehung von Leben aus toter Materie, vorzuführen, warum klammern sich so viele an die Vorstellung, dass sie tatsächlich stattgefunden hat? Das ist umso erstaunlicher, als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebilde mit der Fähigkeit zur Fortpflanzung spontan aus toter Materie entsteht, berechnet nach den Wahrscheinlichkeiten der erforderlichen Einzelschritte, derart gering ist, dass ein solcher Vorgang eine Zeitspanne in Anspruch nehmen würde, die um ein Mehrfaches länger ist als die bisherige Lebensdauer des Universums (14 Milliarden Jahre).
Wenn die Frage der Entstehung des Lebens aus toter Materie die Biologen verwirrt, plagen sich die Physiker mit der Frage, wie die Materie aus dem Nichts entstanden sein soll. Erinnern wir uns daran, dass eine sichtverändernde Folge der Urknalltheorie die Erkenntnis war, dass das Universum einen Anfang gehabt haben musste. Da nun aber der Urknall als Anfangspunkt der Entstehung von Materie, Raum und Zeit gilt, stellt sich die Frage, wie und warum die Materie und das Universum entstanden sind, denn wie kann etwas ohne Grund und Ursache aus dem Nichts entstehen?
Stephen Hawking, der vor Kurzem verstorbene Physiker, der als größter Naturwissenschaftler unserer Generation galt, gab in seinem Buch The Grand Design (2010) folgende unbefriedigende Antwort auf diese Fragen:
„Da es ein Gesetz wie das Gesetz der Schwerkraft gibt, kann und wird sich das Universum aus dem Nichts erschaffen . . . Die spontane Entstehung von etwas aus dem Nichts ist der Grund dafür, dass es etwas und nicht Nichts gibt, dass es das Universum gibt, dass es uns gibt. Wir brauchen dafür keinen Gott“ (Seite 180).
Diese Antwort ergibt aber keinen Sinn, denn sie wirft die Frage auf, warum es überhaupt das Gesetz der Schwerkraft gibt, wo es herkam und warum das Weltall wie für das Leben geschaffen erscheint. Außerdem hat ein Gesetz wie das Gesetz der Schwerkraft keinerlei schöpferische Fähigkeiten und schon gar keine Fähigkeit, etwas aus dem Nichts zu zaubern.
Der Apostel Paulus lässt keinen Zweifel an seiner Meinung über Leute, die die Existenz des Schöpfergottes nicht anerkennen wollen: „Sie [die Menschen, die Gott ablehnen] tun, was Gott missfällt, und treten so die Wahrheit mit Füßen. Dabei gibt es vieles, was sie von Gott erkennen können, er selbst hat es ihnen ja vor Augen geführt. Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken, der Schöpfung, haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung“ (Römer 1,18-20; „Hoffnung für alle“-Übersetzung).
Makroevolution und Abiogenese entsprechen nicht der Wirklichkeit und stellen keine soliden Naturwissenschaften dar. Weder das eine noch das andere wurde jemals beobachtet. Beiden fehlt außerdem die Fähigkeit, die Entstehung des Lebens innerhalb der bisherigen Lebenszeit des Universums zu erklären.
Doch trotz fehlender Beweise und mathematischer Unmöglichkeiten und trotz mancher Gegenbeweise akzeptieren viele Menschen diese falschen Vorstellungen – Makroevolution und Abiogenese. Das ist ein riesiger Glaubenssprung, der über die Tatsache hinwegsieht, dass diese Begriffe nicht erklären, warum etwas existiert, obwohl die Fakten dagegen sprechen. Wie Paulus weiter ausführt: „Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn . . .“ (Römer 1,28).
Auf der anderen Seite ist es möglich, lebensnotwendige Systeme auszumachen, die nur als Ganzheiten funktionieren können. Diese Systeme können nicht durch Zufall entstanden, sondern müssen durch die Planung und Mühe einer obersten Intelligenz geschaffen worden sein. Wenn wir das Weltall betrachten, merken wir, dass es nicht nur menschliches Leben erlaubt und erhält, sondern dass es das entgegen allen Wahrscheinlichkeitsberechnungen, die auf der Annahme von Zufälligkeit beruhen, tut. (Siehe hierzu den Beitrag „Die Wiege des Lebens: Das Universum“ auf Seite 4.)
Die sichtbare Welt und die Fülle der Lebensformen darin auf blinden Zufall zurückzuführen ist einfach unsinnig. Alles im Universum ist das Werk eines Meisters, eines Schöpfers mit überragender Intelligenz und Macht. Sprüche 8 beschreibt die Erschaffung des Alls als eine Leistung von Weisheit, nicht von Zufall!
In übertragener Sprache wird die Weisheit als Sprecherin dargestellt. Sie sagt: „Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt . . ., als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe . . . als er die Grundfesten der Erde legte . . .“ (Sprüche 8,22-29).
Vor Tausenden von Jahren schon teilte uns Gott naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit: „So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen“ (Jesaja 42,5). Gott schafft die Himmel nicht nur, sondern breitet sie auch aus. Das passt genau zu dem, was Naturwissenschaftler in neuester Zeit entdeckt haben!
Das ist aber noch nicht alles. Vielmehr hat Gott auch die Erde als perfekte Umwelt für das menschliche Leben bereitet. Er hat in seiner Schöpfertätigkeit das von Louis Pasteur formulierte Prinzip der Biogenese vorgeführt, wonach Leben nur von Leben kommen kann. Aus der göttlichen Beschreibung dieses Vorgangs geht hervor, dass das Leben des Menschen nicht vom Staub der Erde stammte, aus dem sein Körper gebildet worden war, sondern vom Atem Gottes kam (1. Mose 2,7).
Wie die Bibel zeigt, ist Gott selbst, im Gegensatz zum Universum, ohne Anfang. Er wurde also nicht von einem anderen Wesen geschaffen. Er existiert einfach schon immer, wie man es früher vom Weltall meinte. Zu seinem Leben sagt Johannes: „[Der] Vater [hat] das Leben in sich selber“ (Johannes 5,26). Wie die Existenz Gottes das physische Weltall überragt und für dessen Entstehung verantwortlich ist, so überragt auch Gottes Wesensart die allen anderen Lebens und ist die Quelle davon!
Der Gott der Bibel hat alles geplant, was der Mensch sehen kann – ob mit dem bloßen Auge oder durch ein Instrument wie ein Fernrohr oder Mikroskop. Wie es Paulus in Römer 1, Vers 20 ausdrückte, sind wir alle ohne jegliche Entschuldigung. Wenn wir die Existenz Gottes in Frage stellen, tun wir es mutwillig. Wenn wir unsere gottgegebenen Fähigkeiten der Beobachtung und des sachlichen Denkens einsetzen, können wir die Wahrheit der Existenz, der Macht, der Weisheit und der Herrlichkeit Gottes bestätigen!
Neuere Forschungen lassen den Schluss zu, dass das Leben, wie wir es kennen, nicht existieren könnte, wenn das Universum auch nur ein wenig anders wäre, als es ist. Diese Erkenntnis, dass eine Feinabstimmung zu herrschen scheint, die das menschliche Leben erst möglich macht, wird häufig mit dem Begriff „anthropisches Prinzip“ zusammengefasst.
Der verstorbene Physiker Stephen Hawking bekannte sich in seinem berühmten Buch Eine kurze Geschichte der Zeit überraschend zum anthropischen Prinzip und wies dabei auf bestimmte Naturkonstanten hin, deren Werte fein aufeinander abgestimmt zu sein scheinen, um die Entwicklung des Lebens möglich zu machen.
Was haben diese Naturkonstanten mit der Möglichkeit des Lebens zu tun? Erstens, die Geschwindigkeit, mit der sich das Weltall ausdehnt, hängt von der Größe verschiedener Kräfte ab. Wäre diese Geschwindigkeit höher als sie ist, gäbe es zwar verstreute Gasbildungen, aber weder Sterne noch Planeten. Damit wäre das uns bekannte Leben unmöglich. Wäre die Ausdehnungsgeschwindigkeit aber geringer als sie ist, wären schwarze Löcher viel häufiger entstanden und ebenso kein Leben möglich.
Wenn Sterne Wasserstoff verbrennen, um Licht zu erzeugen, findet Kernfusion statt. Diese Kernfusion führt zur Entstehung von Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und allen anderen Elementen, die für das Leben notwendig sind. Sie schafft auch die Voraussetzungen für die Entstehung von Planeten, auf denen Leben überhaupt existieren kann. Die Kernfusion hängt aber ihrerseits von der Stärke der nuklearen Kraft – einer weiteren Naturkonstante – ab. Wenn die Stärke dieser nuklearen Kraft ein wenig anders wäre, würde die Kernfusion nicht stattfinden.
Die Werte vieler Naturkonstanten – deren Anzahl von manchen mit über einhundert angegeben wird – müssen sich nach Angaben von Naturwissenschaftlern in sehr engen Grenzen halten, damit der komplizierte und lange Vorgang der Planetenbildung so vor sich gehen kann, dass die Voraussetzungen für Leben geschaffen werden.
Die Anzahl der möglichen Universen, die keine Bildung von Sternen und Planeten und schon gar kein komplexes Leben zugelassen hätten, ist unvorstellbar hoch. Wie der Physiker Paul Davies schreibt:
„Unter Physikern und Kosmologen herrscht ziemliche Einigkeit darüber, dass das Weltall in mancher Hinsicht auf das Leben fein abgestimmt ist“ („How Bio-Friendly Is the Universe?“, International Journal of Astrobiology, April 2003).
Da die Entstehung des Lebens aus toter Materie Naturgesetzen widerspricht und die „Evolution“ der Vielfalt an heutigen Lebensformen mathematisch unmöglich ist, gibt es neuerdings die Vorstellung von unendlich vielen Universen – „Multiversen“ genannt.
In manchen dieser Universen sollen andere Naturgesetze herrschen als in unserem Weltall. Auf diese Weise sollen die Wahrscheinlichkeitsberechnungen aufgehoben werden, nach denen ein Weltall wie das unsere nicht durch blinden Zufall entstehen konnte.
Wir haben es hier nicht mit einer naturwissenschaftlichen Theorie, sondern mit einem Hirngespinst zu tun! Brian Keating, Professor für Physik an der Universität von Kalifornien in San Diego, bringt es auf den Punkt: „Die selben Naturwissenschaftler, die Gottes Existenz aus Beweismangel ablehnen, klammern sich an einer Theorie, die so umfassend und ungenau ist, dass sie nie widerlegt werden kann“ („What’s a Greater Leap of Faith: God or the Multiverse?“, PragerU, 23. April 2018). Durch die Fähigkeiten des Beobachtens der Natur und ihrer Gesetzmäßigkeiten sowie des Denkens können wir zu einem fundierten Glauben an den Schöpfergott gelangen!
– Gute Nachrichten September-Oktober 2018
![]()
| Gute Nachrichten Postfach 301509 D-53195 Bonn |
|
| Telefon: | (0228) 9 45 46 36 |
| Fax: | (0228) 9 45 46 37 |
| E-Mail: | info@gutenachrichten.org |
[ Inhaltsverzeichnis ] [ ![]() Artikel drucken ]
[ Artikel kommentieren ]
Artikel drucken ]
[ Artikel kommentieren ]